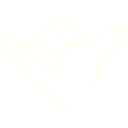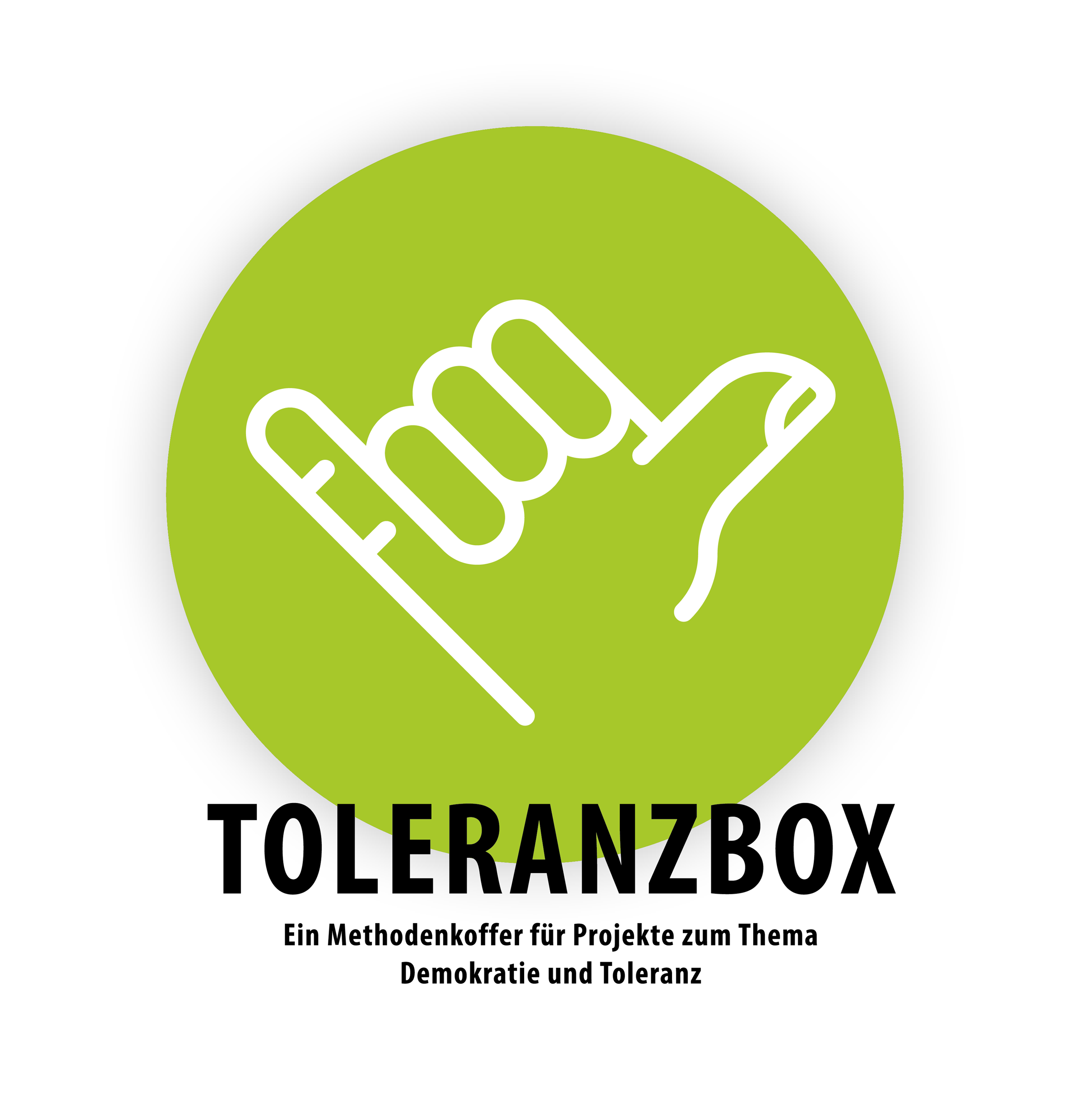

Die Toleranzbox ist ein Kooperationsprojekt der Schulsozialarbeit des Starthilfe Ausbildungsverbunds Schwalm-Eder e.V. und der Jugendförderung/Projekt „Gewalt geht nicht!“ des Schwalm-Eder-Kreises.
Der Methodenkoffer richtet sich an Kinder und Jugendliche aus allen Schulen der Sekundarstufe I und II aus dem Schwalm-Eder-Kreis und wendet sich an Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen.
Der Methodenkoffer soll für Unterrichtsstunden sowie Projektstunden oder -tage genutzt werden. Die Schulsozialarbeiter*innen haben hierfür eine Sammlung von Spielen, Übungen und Methoden zur Verfügung gestellt. In der Box sind alle erforderlichen Materialien enthalten. Gleichzeitig steht eine Website begleitend zur Verfügung.
Es gibt vier Toleranzboxen, die jeweils an ausgewählten Schulen bereitstehen. Um den Methodenkoffer einzusetzen, kann man ihn dort buchen und abholen. Die Nutzung ist kostenfrei.
- König-Heinrich-Schule – Schladenweg 43, 34560 Fritzlar, Tel.: 05622 996980
Email: poststelle@gym.fritzlar.schulverwaltung.hessen.de
- Erich-Kästner-Schule – Schlesierweg 1, 34576 Homberg, Tel.: 05681 7073
Email: hhass@starthilfe-abv.de
- Fuldatal-Schule – Schloth 21, 34212 Melsungen, Tel.: 05661 3111
Email: poststelle@pb.melsungen.schulverwaltung.hessen.de
- BerufsschulCampus Schwalmstadt – Dammweg 5, 34613 Schwalmstadt, Tel.: 06691 6051
Email: poststelle@bs.ziegenhain.schulverwaltung.hessen.de
Wir möchten erreichen, dass sich Kinder und Jugendliche bereits früh mit Themen wie Vorurteilen, Diskriminierung, Toleranz und Rücksicht, Kooperation und Teamwork auseinandersetzen.
Wir verfolgen einen präventiven Ansatz und möchten Pädagog*innen Hilfestellungen geben, Demokratie und Toleranz schon frühzeitig zu fördern.
Für Schulsozialarbeiter (mit Login):
Für Interessierte:
Sieben wichtige Gedanken zur Spielanleitung
Erleben und Lernen gehören unmittelbar zusammen. Wissen, das ich mit einer positiven Erfahrung verknüpfen kann, wird als relevant in meinem Gedächtnis abgespeichert. Um das Spielen als pädagogische Methode brauchbar zu machen, ist die Rolle und Funktion des Spielleiters von entscheidender Bedeutung.
In diesem Sinne sollen die folgenden 7 Punkte, die mit etwas Erfahrung und Übung zu einer positiven Routine werden können, dabei helfen, das Spielen im pädagogischen Kontext mit Qualität zu füllen.
1) Das Spiel kennen
Bevor ich ein Spiel anleite, sollte ich mich gründlich mit den Regeln und Grenzen des Spiels auseinandersetzen. Das versetzt mich in die Lage, bei der Spielanleitung verständlich und klar genug sein zu können. Ein erneutes Aushandeln von Regeln oder Erklären der Aufgabenstellung während des Spielverlaufs ist äußerst hinderlich für die Spielsituation. Es kann in diesem Zusammenhang hilfreich sein, ein unbekanntes Spiel zunächst im Rahmen des Mitarbeiterteams durchzuspielen, um es im Vorfeld nicht allein theoretisch, sondern auch praktisch kennen zu lernen. Oft erschließt sich der pädagogische Nutzen des Spiels für die Gruppe im eigenen Erleben viel deutlicher.
2) Das Spiel anpassen
Jedes Spiel besitzt ein Potential der Anpassung. So gibt es sogenannte „Stellschrauben“, um den Anspruch zu verringern oder zu erhöhen. Denn es macht einen Unterschied, ob ich ein Spiel mit Erwachsenen oder mit Grundschülern durchführe. Auch beschränkt oder erweitert das Umfeld (eine Wiese, ein Waldstück, ein Seminarraum, etc.) und die materielle Ausstattung den Rahmen eines Spiels.
So sollte jedes Spiel im Hinblick auf die konkrete Gruppe und die äußeren Bedingungen im Vorfeld angepasst werden, ohne den Charakter und die inhaltliche Ausrichtung des Spiels wesentlich zu verändern.
3) Das Spiel wollen
Nur wer selber gerne spielt, kann das Spielen motivierend präsentieren. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob ich zum Spielen schicke oder ob ich zum Spielen einlade. Spiele die ich selber nicht spannend finde, kann ich schwer als „gut“ bzw. lohnenswert vermitteln. So ist es hilfreich, sich ein Portfolio an Spielen aufzubauen hinter denen ich voll und ganz stehe, an denen ich selber „Spaß habe“ und die meiner Person entsprechen. Ein Spielleiter sollte sich selbst auf das Spiel voll und ganz einlassen können. Nur so kann es gelingen, das Spiel motivierend zu vermitteln.
4) Das Spiel verpacken
Ein Spielleiter sollte bei den Teilnehmern Freude und Phantasie wecken. Dies kann z.B. durch die Einbindung des Spiels in eine spannende Geschichte geschehen. Vor allem bei Kindern ist dies sehr wichtig. Durch Phantasie und Geschichten kann man häufig bewirken, dass Gruppen „ehrlich“ ins Spielen kommen. Es geht dann nicht mehr darum etwas richtig zu machen, sondern die Teilnehmer können im Spielen authentisch sein.
5) Das Spiel loslassen
Während des Verlaufs muss der Spielleiter im Kopf präsent bleiben (auch als Wächter über die Spielregeln und Grenzen) und dennoch möglichst weit im Hintergrund verschwinden. Dies variiert natürlich je nach Zusammensetzung der Gruppe. In der Regel benötigen jüngere Kinder mehr Begleitung als ältere. Die Grundausrichtung sollte immer sein, dass der Gruppe möglichst viel Raum zur Eigenständigkeit im Planen und Handeln gegeben wird. Im Sinne von Punkt 1 und 2 kann ein gut vorbereitetes Spiel vom Spielleiter nach dem „Startschuss“ losgelassen werden, um so einen ungestörten und authentischen Verlauf zu ermöglichen
6) Das Spiel beobachten
Jeder Spielverlauf besitzt „Goldene Momente“, die ich nicht verpassen sollte! Dies können Äußerungen der Teilnehmer sein, die man in der Reflexion des Spiels (s. Punkt 7) zitieren kann. Sätze, wie: „Komm, ich halte dich fest!“ oder: „Hier ist noch Platz für dich“ können wertvolle Brücken sein, um das Spiel im Anschluss mit der Gruppe in den Alltag zu transferieren. Dies können aber auch Situationen sein, die zu starken „Bildern“ werden. Ein solcher Moment könnte z.B. sein, wenn sich Teilnehmer zueinander ausstrecken, um sich helfend die Hand zu reichen. Es macht Sinn, sich während der Durchführung Notizen von diesen „Goldenen Momenten“ zu machen, um diese während der Reflexion präsent zu haben.
7) Das Spiel reflektieren
Eine Reflexion sollte, wann immer möglich, unmittelbar nach der Durchführung des Spiels stattfinden, sodass das Erlebte frisch und unverfälscht ist. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass jeder, der will, die Möglichkeit bekommt sich zu beteiligen. Allerdings kann eine Reflexion das Erleben des Spiels auch „kaputt reden“. Daher sollte ich (insbesondere bei jüngeren Teilnehmern) auf eine kurze und kompakte Reflexion achten und gegebenenfalls das Gesagte am Ende bündeln. Im Idealfall verknüpfe ich meine eigenen Eindrücke und Beobachtungen mit den Aussagen der Teilnehmer. Ist es nicht möglich eine Reflexion im direkten Anschluss an ein Spiel zu machen, ist es hilfreich, einen Gegenstand des Spiels (z.B. ein Seil) mitzubringen, oder für die Reflexion an den Ort zurückzugehen, an dem das Spiel stattgefunden hat. Dies hilft den Teilnehmern das tatsächlich Erlebte in Erinnerung zu bringen.
Pascal Bewernick